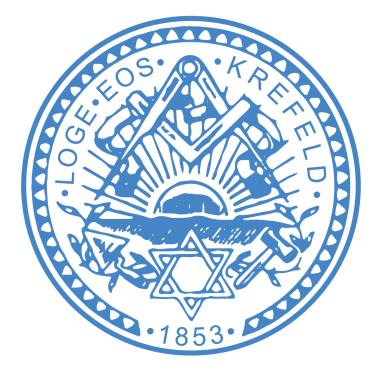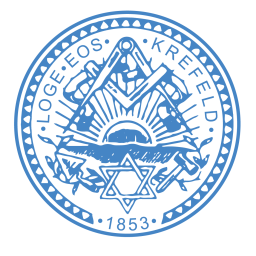Krefeld, im Jahr 1105 erstmalig urkundlich erwähnt und 1373 mit den Stadtrechten ausgestattet, hat eine bewegte Geschichte. Ursprünglich von den Herzögen von Kleve belehnt, fiel die Stadt im Jahr 1702 an Preußen, nachdem das moersische Grafengeschlecht ausgestorben war. Im Friedensvertrag von Basel im Jahr 1795 übertrug Preußen seine Gebietshoheit über seine linksrheinischen Gebiete an die Französische Republik. 1804 wurde durch den Friedensvertrag von Lunéville die territoriale Souveränität dieser Gebiete an Frankreich übertragen, als Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.
Nach dem Ende der Befreiungskriege trat Frankreich diese Gebiete im Friedensvertrag von Paris 1814 an das hieraus neu entstandene Generalgouvernement der alliierten Mächte (Russland, Österreich und Preußen) ab. Die endgültige Neuordnung erfolgte dann auf dem Wiener Kongress im Jahr 1815, nach dessen Schlussakte die linksrheinischen Gebiete an Preußen fielen.
Zu diesem Zeitpunkt war Krefeld eine bedeutende Textilgewerbe- und Handelsstadt. Die Seidenmanufaktur, die im 17. Jahrhundert von aus den Niederlanden eingewanderten Mennoniten und aus der Bayerischen Pfalz stammenden Reformierten eingeführt wurde, erlangte Weltgeltung. König Friedrich Wilhelm I. in Preußen (1713 – 1740) befreite daher die Krefelder Bürgerschaft von der militärischen Aushebung.
Während der französischen Fremdherrschaft, in der Krefeld zum Departement de la Roer gehörte, beteiligten sich mehrere namhafte Logenmitglieder an der munizipalen und departementalen Verwaltung und bekleideten Ehrenämter. Krefeld hatte in den Jahren 1787 und 1804 jeweils 7.896 bzw. 8.363 Einwohner und war somit eine mittelgroße Stadt.
Krefelds erste Loge
Das Preußische Geheime Staatsarchiv besitzt keine Akten der Loge "Zur vollkommenen Gleichheit", da die vorhandenen Akten bei der Schließung der Loge "Eos" im Jahr 1935 von der Geheimen Staatspolizei vernichtet wurden. Die Darstellung basiert auf Logengeschichten von Karl Pistorius, Guido Rotthoff und Egon Wiegel.
Obwohl Krefeld alle Voraussetzungen für eine Loge hatte, wurde die Freimaurerei erst ein halbes Jahrhundert nach ihrem Aufkommen im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation etabliert. Hinderungsgründe könnten die mitgliederstarken Logen in der Nachbarschaft und konfessionelle Gründe sein, da die Mennoniten nicht zu den anerkannten Konfessionen gehörten und die Eidesleistung ablehnten.
Die Initiative zur Gründung der Loge "Zur vollkommenen Gleichheit" ging von acht Krefelder Freimaurern aus, die Mitglieder von Logen in Aachen, Frankfurt am Main und Neuwied waren. Die Loge erhielt am 10. Oktober 1788 ein Konstitutionspatent von der Großen Mutterloge des Eklektischen Freimaurerbundes und wurde von Wilhelm Elias Weidenfeld installiert. Die Loge wurde am 9. November 1788 eingeweiht und Engelbert vom Bruck wurde ihr Leiter.
Es scheint, dass vom Bruck die Gründung der Krefelder Loge lediglich der eigenen Großloge mitteilte und weder den preußischen Behörden noch den Altpreußischen Großlogen davon berichtete. Die Krefelder Loge, die eine Tochterloge der Großloge war, wollte jedoch eine hohe Autonomie bewahren und war der Auffassung, dass die Großloge nur die Exekutivgewalt hätte, jedoch nicht berechtigt wäre, selbstständige Beschlüsse zu fassen und ihre Beschlüsse den einzelnen Logen aufzuzwingen.
Im Rechtsstreit zwischen der Großen Mutterloge des Eklektischen Freimaurerbundes und der Loge "Zum Kompaß" in Gotha, die sich den Vereinigungsbemühungen anschloss und einen allgemeinen deutschen Logenbund gründen wollte, neigte die Krefelder Loge dem Gothaischen Standpunkt zu und erklärte förmlich ihren Beitritt zu diesem Bund. Doch der Erste Koalitionskrieg machte alle Pläne zunichte.
Die Große Mutterloge des Eklektischen Freimaurerbundes stellte am 8. Juni 1793 ihre Tätigkeit ein, und die Loge "Zur vollkommenen Gleichheit" tat dies am 6. September 1794. Aufgrund des Krieges, der nachfolgenden militärischen Besetzung Krefelds und dem Weggang des Meisters vom Stuhl, Johannes Lang, ruhte die Loge sieben Jahre lang. Erst am 15. Januar 1801 trat sie auf Initiative des letzten Meisters vom Stuhl, nunmehr unter dem Namen "La parfaite égalité", wieder zusammen.
Nach der Wiedereröffnung der Großloge im Jahr 1801 bekannte sich die Loge am 6. November 1802 als deren Tochter. Es gab jedoch Überlegungen, der französischen Großloge "Grand Orient de France" beizutreten, da Krefeld unter der Gebietshoheit der französischen Besatzungsbehörden stand. In dem Richtungsstreit zwischen vom Bruck und v. Löwenich erhielt schließlich die frankophile Gesinnung eine Mehrheit. Vom Bruck trat 1805 vom Amt des Meisters vom Stuhl zurück und 1807 schließlich aus der Loge aus. Die Loge wählte daraufhin Peter v. Löwenich zum Meister vom Stuhl.
Im Jahr 1808 genehmigte der Grand Orient die Affiliation, jedoch ist fraglich, ob es zu einer Konstituierung aufgrund des französischen Patents kam. Die Loge arbeitete nachweislich noch bis 1810, soll aber noch bis 1818 bestanden haben. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Loge nach der Rückgliederung Krefelds in das Königreich Preußen nach dem Wiener Kongress 1815 eine polizeiliche Zulassung erhalten hätte, da sie ohne ein Konstitutionspatent einer der drei Altpreußischen Großlogen eine illegale Vereinigung gewesen wäre.
Die Johannisloge „EOS“
Nachdem die Befreiungskriege im Jahr 1815 zu Ende gegangen waren und Krefeld wieder Teil von Preußen geworden war, vergingen fast 40 Jahre, bis die Stadt ihre erneut eine Freimaurerloge bekam. Im Jahr 1853 wurde die Johannisloge "Eos" gegründet, nachdem sich einige Mitglieder der in Rheydt ansässigen Johannisloge "Vorwärts" für die Stiftung einer neuen Loge in Krefeld eingesetzt hatten.
Zu dieser Zeit war die Einwohnerzahl der Stadt auf etwa 40.000 angewachsen, und die wirtschaftlichen Verhältnisse hatten sich verbessert. Bereits 1847 hatte sich in Krefeld ein freimaurerisches Kränzchen namens "Aurora zur vollkommenen Gleichheit" gebildet, das sich für die Namensgebung der neuen Loge "Eos" einsetzte. Allerdings gab es bereits eine Loge namens "Aurora" in Minden, daher wurde stattdessen der Name "Eos" gewählt.
Von der alten Krefelder Loge waren zu diesem Zeitpunkt nur noch zwei Mitglieder übriggeblieben: Friedrich Wilhelm Hoeninghaus und Heinrich vom Bruck. Sie verstarben 1854 bzw. 1861.
Die Gründung der Johannisloge "Eos" in Krefeld im Jahr 1853 war das Ergebnis von Initiativen einiger Mitglieder der Johannisloge "Vorwärts" aus Rheydt. Das Ziel war es, eine neue Loge in Krefeld zu etablieren und sie ebenfalls der Großen National-Mutterloge "Zu den drey Weltkugeln" anzugliedern. Allerdings wurde das Vorhaben von Johann Wilhelm Nonnenbruch, der in Solingen in der Johannisloge "Prinz von Preußen - Zu den drei Schwertern" aufgenommen worden war, durchkreuzt. Nonnenbruch konnte die Stifter davon überzeugen, die neue Loge der "Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland" anzuschließen, was bis heute der Fall ist.
Die Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland ist eine der drei Altpreußischen Großlogen und stand unter dem Protektorat der Könige von Preußen. Sie pflegt eine nationale und militärische Tradition und folgt der "Schwedischen Lehrart", einer christlich-protestantischen Variante der Freimaurerei, wie sie in Skandinavien - mit Ausnahme von Finnland - gepflegt wird.
Am 14. März 1853 erhielt die Johannisloge "Eos" das Konstitutionspatent Nr. 102 und am 11. Juni desselben Jahres wurde die Loge im Hotel Oberheim an der Ecke Hochstraße und Marktstraße in Krefeld eingeweiht. Die Stifter der Loge waren Wilhelm Kreeft, Johann Wilhelm Nonnenbruch, Friedrich Ernst Nauck, Friedrich Wilhelm Altgeld, Gerhard Andres von Garrelts, Heinrich Adolf Heilgers, Robert Weyer und Friedrich Christian Oberheim.
Garrelts war bereits 1840 Stifter der Johannisloge "Prinz von Preußen - Zu den drei Schwertern", während Nauck das bis heute verwendete Logenbijou entworfen hat. Nonnenbruch wurde 1841 in die Johannisloge in Solingen aufgenommen und übernahm im Gründungsjahr das Amt des Vorsitzenden Logenmeisters.
Zwei Jahre nach der Gründung bot sich 1855 die Gelegenheit, ein Grundstück an der Königstraße zwischen Südwall, Petersstraße und Mittelstraße für 6.000 Thaler zu erwerben. 1857 begann man mit der Planung eines eigenen Logenhauses, das schließlich 16.580 Thaler kostete. Am 8. Juli desselben Jahres wurde anlässlich der Grundsteinlegung eine Kapsel mit Logenbelegen eingemauert, die jedoch bei Ausschachtungsarbeiten im Jahr 1998 nicht mehr gefunden wurde.
Schließlich wurde das Logenhaus am 22. August 1858 auf der Königstraße 5 eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben. Die Räumlichkeiten des Logenhauses waren bereits bei der Planung so gestaltet worden, dass auch die 1855 in Solingen gestiftete Andreasloge "Conjuncta" und das 1868 gestiftete "Rheinische Provinzial-Ordenskapitel Conjuncta" dort untergebracht werden konnten.
Die Johannisloge "Eos" konnte in den ersten Jahrzehnten nach ihrer Gründung eine stetige Zunahme ihrer Mitgliederzahlen verzeichnen. Dadurch erweiterten sich auch ihre finanziellen Aktivitäten im Bereich der Caritas. So unterhielt sie eine Armenkasse und gründete im Jahr 1856 eine "Witwen- und Waisenstiftung". Darüber hinaus war die Loge Mitglied mehrerer Stiftungen wie der "König-Wilhelm-Stiftung", der "Victoria-Stiftung", der "Kronprinz-Friedrich-Wilhelm-Stiftung" sowie der "Augusta-Stiftung".
1883 wurde der Johannisloge ein stattliches Ölgemälde durch den damaligen deutschen Kaiser und König Wilhelm I. von Preußen (1861-1888) gewidmet, nachdem die Loge ein entsprechendes Gesuch eingereicht hatte. Das Gemälde wurde anlässlich des Stiftungsfestes des Ordenskapitels "Conjuncta" am 23. Dezember 1883 vom damaligen Ordensmeister Alexis Schmidt übergeben und hing bis zur Zwangsauflösung im Jahr 1935 im Tempel. Glücklicherweise konnte es der Beschlagnahme durch die Geheime Staatspolizei entgehen und befindet sich noch heute im aktuellen Logenhaus.
In der Amtszeit des Vorsitzenden Logenmeisters Dr. Friedrich Höchtlen von 1923 bis 1932 erlebte die Johannisloge „Eos“ ihre erfolgreichste Phase. Mit insgesamt 269 Mitgliedern erreichte sie ihren höchsten Mitgliederbestand. Während ihrer Entwicklung gewann die Loge auch Mitglieder aus benachbarten Städten. Diese Mitglieder äußerten den Wunsch, freimaurerische Gruppen und Vereinigungen an ihren Wohnorten zu gründen, die von der Johannisloge "Eos" betreut werden sollten.
Folglich entstanden mehrere Gesellschaften, die der Johannisloge "Eos" angeschlossen und von ihr betreut wurden. 1892 wurde in Moers die Freimaurerische Vereinigung "Ernst und Falk" gegründet, gefolgt von der Gründung des Freimaurerischen Kränzchens "Rose und Akazie" in Düsseldorf im Jahr 1895. 1898 wurde in Köln das Freimaurerische Kränzchen "Freimut und Wahrheit" gegründet, während in Homberg am Niederrhein im Jahr 1911 die Freimaurerische Vereinigung "Zur Wacht am Rhein" entstand. Schließlich wurde 1912 in Duisburg das Freimaurerische Kränzchen "Mercator zum Zirkel" gegründet.
Die Gründung dieser freimaurerischen Gruppen und Vereinigungen trug dazu bei, dass die Johannisloge "Eos" auch in ihrem Umland sichtbarer wurde. Aus den Kränzchen in Düsseldorf und Köln entstanden 1897 bzw. 1904 eigenständige Johannislogen mit dem gleichen Namen. Die Vereinigung in Duisburg bestand bis mindestens 1927 weiter, während diejenigen in Homberg am Niederrhein und Moers bis zu ihrer Zwangsauflösung im Jahr 1935 aktiv waren.
Am Ende der Weimarer Republik spürte die Johannisloge zunehmend in die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise, der Massenarbeitslosigkeit und der politischen Agitation republikfeindlicher Kräfte, insbesondere nach dem Regierungsantritt von Adolf Hitler im Jahr 1933. Mit der allgemeinen "Gleichschaltung" des Deutschen Volkes begann eine Zeit der Veränderung, in der sich viele Vereine und Berufsvertretungen in entsprechende nationalsozialistische Organisationen umwandeln oder auflösen mussten. Dies traf auch auf Freimaurerlogen zu, deren Mitglieder de facto zum Austritt aus den Logen bewogen wurden, da ihnen ansonsten die Zwangspensionierung oder der Ausschluss aus dem Beamtenverhältnis drohte.
Am 29. Juni 1935 feierte die Johannisloge Eos ihr letztes Johannisfest, am 20. Juli 1935 wurde dann die Auflösung der Johannisloge vollzogen.
Zu diesem Zeitpunkt verzeichnete die Loge über 202 Mitglieder. Von der Stiftung bis zur Zwangsauflösung wurden insgesamt 739 Mitglieder aufgenommen.
Nachdem die Freimaurerloge aufgrund von Zwangsauflösung geschlossen worden war, trafen sich einige Mitglieder weiterhin regelmäßig im "Montagskreis". Jedoch wurden 24 Mitglieder von der Geheimen Staatspolizei überwacht und mussten zahlreiche Einschränkungen wie Postkontrollen, Wohnungsdurchsuchungen und Beschlagnahmungen erdulden. Einige erlitten dienstliche Nachteile und andere traten aus der Loge aus, um Mitglieder nationalsozialistischer Organisationen zu werden.
Schließlich wurde am 25. September 1935 das Logengebäude beschlagnahmt und das Vermögen der Loge wurde bis zum 6. Mai 1939 liquidiert. Während dieser Zeit hatte die Geheime Staatspolizei das gesamte bewegliche Logeninventar aus dem Haus geräumt und die Ritualgegenstände dem "Westdeutschen Freimaurer-Museum" in Düsseldorf übergeben. Die Bibliothek und das Archiv wurden nach entsprechender Auswertung in die Altpapiersammlung gegeben.
Obwohl Einsprüche gegen die Beschlagnahmungen erhoben wurden, wurden sie sowohl vom Polizeipräsidenten in Krefeld als auch vom Regierungspräsidenten in Düsseldorf zurückgewiesen. Das Logengebäude selbst wurde am 1. Juli 1937 für RM 25.000 an die Firma Knuffmann verkauft, die es als Möbellager nutzte. Es wurde während des britischen Luftangriffs am 21./22. Juni 1943 vollständig zerstört.
Nach der erzwungenen Auflösung und Liquidation der Johannisloge "Eos" während der Zeit des Nationalsozialismus fanden sich nach dem Ende der geschäftsführenden Reichsregierung am 23. Mai 1945 die in Krefeld verbliebenen Mitglieder wieder zusammen. Schon ab Juni 1945 fanden regelmäßige Besprechungen statt und ab Januar 1946 wurden wieder rituelle Arbeiten durchgeführt, jedoch ohne freimaurerische Bekleidung. Nach der Bewilligung durch das britische Besatzungsregime am 24. April 1947 erfolgte am 4. Januar 1948 die Wiederverleihung der Rechte einer juristischen Person durch den Regierungspräsidenten in Düsseldorf. Bereits 1945 bezog die Loge ihr neues Quartier im Haus Südwall 22, bevor man 1949 zur Petersstraße 60 und 1951 in das Hotel "Krefelder Hof" an der Rheinstraße/Ostwall/Sankt-Anton-Straße umzog. 1967 wurde der "Krefelder Hof" auf Abbruch verkauft und die Loge zog ins Hotel "Haus Schucht" an der Uerdinger Straße um. Nach erfolgreichen Wiedergutmachungsverhandlungen konnte im Jahr 1970 das Logenhaus in der Bismarckstraße 103 erworben werden, in dem bis zum Jahr 2018 gearbeitet wurde. Seit 2019 wird im Haus Rheinstraße 38 gearbeitet.
(Bildquelle: Der Oberbürgermeister, Stadtarchiv Krefeld - Obj. 25008)
Die Chroniken der Loge EOS
Das Bijou
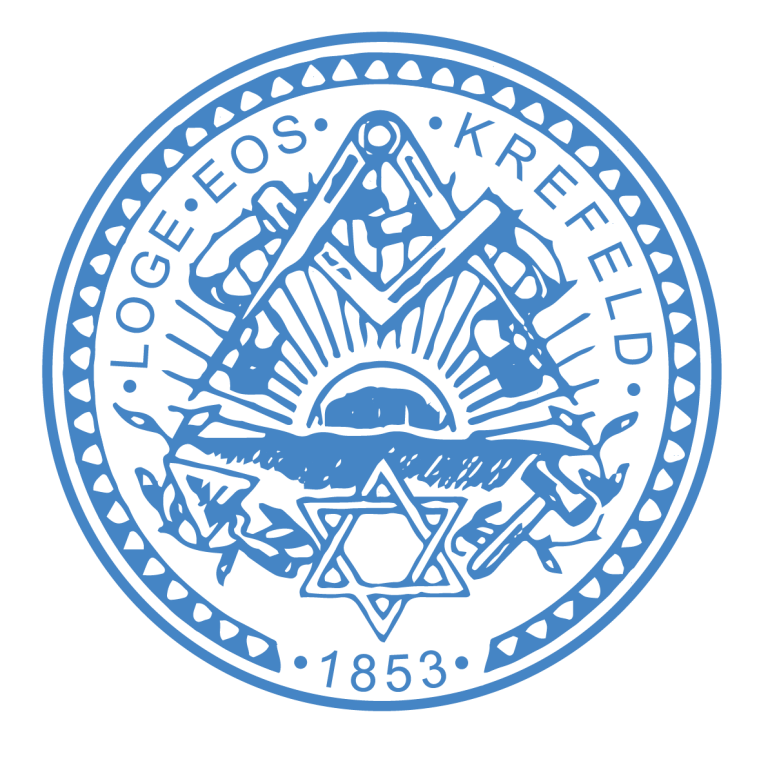
Das heute noch gültige Logensiegel stammt von Friedrich Ernst Nauck (1819 – 1875), einem der Stifter der Loge.
Es ist von himmelblauer Farbe und zeigt in einem dunkel-hell gezackten Kreis die Umschrift „Loge Eos Krefeld 1853“. Im Siegelfeld ist ein Zirkel zu sehen, der auf einem Winkelmaß liegt und durch ein Band umschlungen wird. Begrenzt durch diese Symbole ist eine über dem Horizont aufgehende Sonne zu sehen. Unterhalb des Horizontes befindet sich mittig ein Hexagramm, rechts davon eine Maurerkelle, links davon ein Hammer.
Beide Werkzeuge liegen auf einem Akazienzweig
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.